"Für ein neues Berliner Institut für Sexualwissenschaft". Eine Denkschrift
(1987) - Einleitung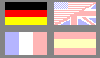
Zur Zielsetzung dieser Denkschrift
Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft setzt sich seit 1982 für die Wiedererrichtung des von den Nazis zerstörten Berliner Instituts für Sexualwissenschaft ein. Wir haben zu diesem Zweck eine ganze Reihe von Aktivitäten entfaltet, von denen hier nur einige aufgeführt seien: Gemeinsam mit der Jüdischen Volkshochschule Berlin veranstalten wir seit 1983 eine Vortragsreihe über historische und aktuelle Themen der Sexualwissenschaft und Sexualreformbewegung; wir haben aus Anlaß des 50. Todestages Hirschfelds eine eigene Ausstellung veranstaltet und uns an vielen anderen mit Materialien beteiligt. Die zehnte Ausgabe der "Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft" ist im Sommer 1987 erschienen; die Schriftenreihe der Gesellschaft wächst mit dieser Denkschrift auf vier Bände.
Wir haben zwar erreichen können, daß das frühere Berliner Institut für Sexualwissenschaft mittlerweile der Vergessenheit entrissen wurde, aber mit unserem Anliegen, ein solches Institut in Berlin wiederzuerrichten, sind wir bisher auf wenig mehr als unverbindliches Wohlwollen gestoßen. So hält der westberliner Senat die Wiedererrichtung zwar prinzipiell für wünschenswert, aber nicht für so vordringlich, daß angesichts der aktuellen Haushaltssituation Gelder dafür zu Verfügung gestellt werden sollten [1]; so vermeidet der damalige Wissenschaftssenator Kewenig in seinem Geleitwort zu unserem Ausstellungskatalog "Magnus Hirschfeld - Leben und Werk" [2] jedes Eingehen auf die Forderung, das Institut wiederzuerrichten.
Die gegen die Neugründung eines Instituts für Sexualwissenschaft vorgebrachten Einwände haben nach unseren bisherigen Erfahrungen wenig Substanz. Sie finden ihren Ausdruck zumeist in den zwei Fragen:
- Es sei nicht klar, was ein solches Institut tun solle; und
- es sei unklar, ob es für dessen mögliche Angebote überhaupt einen Bedarf in Berlin gäbe.
Diese Fragen mögen - nach Art von Leierkastenargumenten - gelegentlich vorgeschoben sein, um nichts tun zu müssen; nichtsdestotrotz scheint es uns sinnvoll, sie zu beantworten. Diesem Zweck soll die vorliegende Denkschrift dienen.
 Grundlagen eines zukünftigen Instituts für Sexualwissenschaft
Grundlagen eines zukünftigen Instituts für Sexualwissenschaft
Bevor wir aber näher auf die uns wesentlichen Grundlagen eines neuen Instituts für Sexualwisenschaft eingehen, halten wir einen Blick auf die Arbeitsbedingungen und Zielsetzungen des 1933 zerstörten Instituts von Magnus Hirschfeld für nötig, da hier der Ausgangspunkt unserer Überlegungen liegt.
Hirschfelds Institut stand in enger personeller und thematischer Verbindung mit den wichtigen sozialen und (sexual)politischen Bewegungen seiner Zeit. Sie waren die Triebkraft hinter seinen Arbeiten; die Wechselbeziehung zwischen dem Institut und den "Abnehmern" seiner Ergebnisse war eine der Bedingungen für seinen Erfolg und seine Bedeutung. Diese Triebkraft der Wissenschaft, geboren aus der vielfach und massenhaft erlebbaren 'Sexualnot' und einem heute unvorstellbaren Ausmaß an Unwissen, besteht nicht mehr. Die heutigen Aufgabenstellungen der Sexualwissenschaft stehen nicht mehr in der engen Verbindung mit organisierten politisch-sozialen Bewegungen. Das Fach ist ein - wenn auch marginaler - Bestandteil des universitären Kanons geworden; die Frage seiner Zuordnung zu den medizinisch/therapeutischen Fächern oder den Sozialwissenschaften ist lediglich eine innerwissenschaftliche Kontroverse.
Die Forschung des Instituts für Sexualwissenschaft war zu einem guten Teil auf die Unterstützung von Emanzipationsbestrebungen - insbesondere der der Homosexuellen - hin angelegt, indem sie getreu Hirschfelds Wahlspruch 'per scientiam ad justitiam' der Aufklärung und dem Abbau von Diskriminierungen dienen wollten. Bei einer Neugründung müßte dieses Verhältnis von Wissenschaft und (Sexual-)Politik sicherlich ebenfalls - themenbezogen - neu bestimmt werden.
Hirschfelds Institut war schließlich so etwas wie eine Heimstatt, ein Zufluchtsort für die Angehörigen sexueller Minderheiten, insbesondere der Homosexuellen, Transvestiten und Transsexuellen; ein (sub)kulturelles Zentrum ganz eigener Art. Für eine wissenschaftliche Einrichtung heute ist das eine unvorstellbare Mischung von Funktionen, die die Distanz der Wissenschaft zu ihrem Objekt nahezu aufhebt. Die beständige persönliche Nähe zu den "Subjekten" der Forschung auch im Alltag bietet andererseits aber die Gewähr dafür, daß sie als Subjekte in ihrer Individualität auch erhalten bleiben - allen Vermessungs- und Kategorisierungversuchen zum Trotz. An diesem Punkt mutet Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft überaus modern an: Wissenschaft und Alltag sind nicht zwei völlig voneinander getrennte Sphären, sondern befruchten und kontrollieren sich gegenseitig und unmittelbar. Solche Bedingungen bestehen heute am ehesten im Rahmen der 'selbstorganisierten' Forschung der Frauen-, Lesben- und Schwulenbewegung; hier wird ein Universitätsinstitut viel zu lernen haben.
Zusätzlich zu diesen, aus der Praxis des früheren Institut für Sexualwissenschaft gewonnenen Grundlagen muß sich unserer Meinung nach eine Neugründung an den folgenden Prinzipien orientieren:
- Das Institut muß seinen Schwerpunkt in den Sozialwissenschaften
haben. Wie Sexualität ge- und erlebt wird, ist immer gesellschaftlich bestimmt. Nur die sozialwissenschaftliche Ansiedelung bietet die Chance, einen neuen Zugang zur Sexualität zu finden: mit einer Zentrierung auf die Lebensbedingungen der Geschlechter, der sexuellen Mehr- und Minderheiten, ihre Verhältnisse zueinander und deren historische Entwicklung. Gunter Schmidt hat in "Das große Der Die Das" [3] die Wichtigkeit kulturhistorischer Untersuchungen klar gemacht. Wir unterstützen die Forderung nach einer Gegenwarts-
Kultursoziologie der Lebensrealität der Geschlechter und der Minderheiten. Wir sind im übrigen nicht der Meinung, daß ein sexualwissenschaftliches Institut auf eine medizinische und psychologische klinische Tätigkeit verzichten sollte. Aber es ist ein Unterschied, ob bei den Kliniker/inne/n auch sozialwissenschaftlich gearbeitet oder ob bei sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt den notwendigsten Erfordernissen der Klinik Rechnung getragen wird. In der Klinik stehen Einzelpersonen im Zentrum der Betrachtung, ihre Lebenszusammenhänge werden zu (Rand)Bedingungen des Leidens. Wir möchten die Lebenszusammenhänge und deren Normalität in den Vordergrund der Forschung rücken. Dies wäre auch ein besonderer Berliner Akzent, zumal die sexualwissenschaftlichen Abteilungen in Hamburg und Frankfurt schon dafür sorgen werden, daß die Forschung, die sich auf die Klinik stützt, nicht ausstirbt. - Das Institut muß interdisziplinär arbeiten. Bisher haben die verschiedensten Disziplinen Beiträge geliefert, die für die Sexualwissenschaft von hoher Bedeutung sind. Der entsprechende Fächerkanon reicht von der Philosophie über Psychologie, Soziologie, Anthropologie bis hin zur Sprachwissenschaft und zur Medizin, um nur einige zu nennen. Da wir der Meinung sind, daß das sexuelle Verhalten im engeren Sinne nur zu verstehen ist, wenn es nicht aus der kulturellen, psychosozialen Realität herausgelöst wird, muß die Sexualwissenschaft alle Wissenschaften vom Menschen auf ihre Verstehensmöglichkeit abklopfen und sie integrieren. Damit bei diesem Unterfangen nicht ein heilloser Eklektizismus herauskommt, ist es erforderlich, gleichzeitig grundlagentheoretische Reflektionen anzustellen, um die Ergebnisse der verschiedenen Einzelwissenschaften sinnvoll aufeinander zu beziehen.
- Die Arbeit des Institutes darf nicht diskriminierend sein. Diese Bedingung ist zweifellos am schwersten zu erfüllen und wird Widerspruch hervorrufen, da sie das Selbstverständnis der bürgerlichen Wissenschaft, sie könne schon deshalb niemanden diskriminieren, weil sie 'objektiv' sei, nicht ernst nimmt. Daß Diskriminierung auch durch Wissenschaft stattfindet, ist eine jahrhundertealte, noch immer nicht überwundene Erfahrung von Frauen, aus der schließlich die Forderung nach und Förderung von Women Studies/Frauenforschung resultierte. Alle sexuellen Minderheiten waren und sind ähnlichen Diskriminierungen unterworfen; einige haben begonnen, sich dagegen zu wehren: Lesben und Schwule sind hier am weitesten. Wir verzichten hier darauf, die Flut offenkündiger Verbalinjurien anzuführen, mit denen Medizin, Anthropologie, Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie den verschiedenen Minderheiten das Leben schwer gemacht haben, anfangs sogar allen Abweichungen von der Norm des heterosexuellen weißen Mannes. Ob eine Untersuchung oder eine Theorie diskriminierend ist und wirkt, ist nicht nur eine Frage innerwissenschaftlicher Kriterien; das hängt vielmehr von den Lebensbedingungen der Betroffenen und dem gesellschaftspolitischen Umfeld ab, in dem Forschung stattfindet. Die Freiheit der 'Betroffenen' und die vielberufene 'Freiheit der Forschung' können hier in Widerspruch zueinander geraten; unsere Erwartung an ein neues Institut für Sexualwissenschaft ist, daß es sich in diesem Konflikt auf die Seite der Betroffenen stellt.
Hier sei eine Bemerkung zur aktuellen Entwicklung in Berlin angeschlossen: Mit der geplanten Einrichtung des Deutschen AIDS-Zentrums beim Bundesgesundheitssamt soll auch sexualwissenschaftliche Forschung in Berlin ermöglicht werden. Dem wird sich niemand widersetzen; nur: Die Reduktion von Sexualwissenschaft auf Gesundheitsvorsorge wäre eine Beschränkung mit der Gefahr der Verfälschung. Sexualwissenschaftliche Fragestellungen aus Anlaß und am Beispiel einer sexuell übertragbaren Krankheit zu untersuchen, die zudem im öffentlichen Bewußtsein unauflöslich mit sexuellen und sozialen Minderheiten verknüpft ist (Schwule, Fixer, Bi-Sexuelle, Prostituierte) birgt die Gefahr fortgesetzter Diskriminierung in sich. Zu befürchten ist, daß im BGA als einer nachgeordneten Behörde genau die Trennung der drei Aspekte Forschung, Ausbildung und Politik wirksam wird, die wir für schädlich halten: Forschung findet dann statt im Auftrag einer Politik, die nichts als Kontrolle im Sinn hat. Im Rahmen des BGA geht zudem die Ausbildungsfunktion, die ein Institut für Sexualwissenschaft haben muß, für die Masse der Studierenden verloren.
Die Einbeziehung sexualwissenschaftlicher Forschungen in das geplante AIDS-Zentrum ersetzt also nicht ein Institut für Sexualwissenschaft in Berlin; im Gegenteil: dessen Gründung wird umso notwendiger, wenn Fehlentwicklungen verhindert werden sollen.
 Zu den Beiträgen dieses Bandes
Zu den Beiträgen dieses Bandes
Wir haben in dieser Denkschrift zum einen eine exemplarische Bestandsaufnahme bestehender Institutionen versucht, die sexualwissenschaftliche Forschung und Lehre betreiben. Zum anderen haben wir Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen und Organisationen sexueller Minderheiten gebeten, ihre Ansprüche und Erwartungen an ein Institut für Sexualwissenschaft zu umreißen. Wir wollen damit deutlich machen, welche Ausrichtung ein solches Institut haben müßte, um einerseits seinen spezifischen Charakter in der internationalen Sexualwissenschaft zu entwickeln und andererseits die bestehende psychosoziale Versorgung in der Stadt zu unterstützen und sinnvoll mit vorhandenen Einrichtungen zusammenzuarbeiten.
Wie die Beiträge erkennen lasen, haben sich in den meisten Praxisbereichen übergreifende Fagestellungen entwickelt, deren Bearbeitung in der Regel den Rahmen bzw. die Möglichkeiten des jeweiligen Projekts/der jeweiligen Beratungsstelle überschreitet. Hier ist grundlegende Forschung nötig, auf die sich die angewandte Praxis beziehen kann. Dabei zeigen selbst die Beiträge aus Beratungsstellen und Selbsthilfeeinrichtungen, die der medizinischen und psychosozialen Versorgung dienen, daß der Bedarf an sexualwissenschaftlichen Forschungen unter medizinischen Aspekten eher gering ist - zumeist aktuell verknüpft mit dem Thema AIDS. Hingegen besteht ein akuter Mangel in der Forschung auf sozialwissenschaftlichem Gebiet und - das gilt für alle Fächer - in der Aus- und Fortbildung, wie die Bedarfsanalyse des Sozialmedizinischen Dienstes Charlottenburg, die hier erstmals veröffentlicht wird, für das Gesundheitswesen belegt. Die vielfältigen Impulse in diesen Beiträgen sollten aufgenommen werden, in ihren übergeordneten Fragestellungen kontinuierlich und qualifiziert bearbeitet werden können und zu einem weiterführenden Fortbildungs- und Lehrangebot führen. Solche Arbeit kann nur auf langfristig angelegter Grundlagenforschung beruhen. Das ist eine Aufgabe, die traditionell in die Zuständigkeit der Universitäten fällt; in Berlin dort aber bisher nicht wahrgenommen wurde.
Es gibt zwar vereinzelte Lehrangebote zu sexualwissenschaftlichen Themen an der Freien Universität Berlin, doch sind diese nach wie vor dem Interesse einzelner Dozentinnen und Dozenten zu verdanken. Das gesamte Angebot ist daher immer noch zufällig und unkoordiniert. Bereits 1984 wurde in der Senatsantwort an das Abgeordnetenhaus festgestellt, daß eine Koordinierung der Lehrveranstaltungen und der Forschung nicht in dem erforderlichen Maße stattfindet. Die einzigen kontinuierlichen, fächerübergreifend zugänglichen Veranstaltungen, die seitdem an der FU durchgeführt wurden, waren eine Ringvorlesung "Sexualität" im WS 1984/84 und die vom AStA initiierte, schon länger laufende Vorlesungsreihe "Homosexualität und Wissenschaft", die auch weiter fortgesetzt wird. Wir sind der Meinung, daß die schon vor drei Jahren geforderte Koordination des Lehrangebots und der Forschungsarbeiten an der FU nun endlich in Angriff genommen werden sollte. Das kann aber nur ein Schritt auf dem Weg zu einem Institut für Sexualwissenschaft sein, denn auf diese Weise kann kaum mehr erreicht werden als die bessere Verwaltung des bestehenden Mangels.
 Zur Ausstattung eines künftigen Instituts für Sexualwissenschaft
Zur Ausstattung eines künftigen Instituts für Sexualwissenschaft
Der Umfang der sinnvollen und notwendigen Personalausstattung eines Instituts für Sexualwissenschaft läßt sich schon aus den nachstehenden Beschreibungen anderer Institute entnehmen. Für die Berliner Planungen sollte von folgendem Mindestbedarf an Stellen ausgegangen werden, der auch bereits 1984 formuliert wurde:
- 2 Professor/inn/en
- 1 Gastprofessor/in
- 4-5 wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
- 2 Sekretäre/Sekretärinnen
- 1 Bibliothekar/in
- 1 Archivar/in oder Dokumentar/in
Als Organisationsform wäre neben der des klassischen Universitätsinstituts auch die besonders auf interdisziplinäre Kooperation angelegte Form des Zentralinstituts denkbar; zur Orientierung kann hier auch das Modell der Utrechter Homostudies dienen.
Obwohl klar ist, daß eine Vergabe von Stellen und die genaue Bestimmung der Arbeitsaufgaben in diesem Stadium nicht zur Diskussion stehen, halten wir es für wichtig, die - zum Teil analogen - Probleme der Geschlechterparität und der Beteiligung sexueller Minderheiten in einem zukünftigen Institut für Sexualwissenschaft schon jetzt zu thematisieren.
Da sich Sexualwissenschaft mit dem sexuellen Verhalten von Frauen und Männern und damit mit der sozialen Realität der Geschlechter befaßt, spielt das Geschlecht der Forscherin/des Forschers bei den Untersuchungen eines besondere Rolle. Die in einem Institut für Sexualwissenschaft zu bearbeitenden Themen können nicht unabhängig vom sozialen Verhältnis der Geschlechter gesehen werden, was am Beispiel der sexuellen Gewalt, die Ausdruck der Unterdrückung von Frauen ist, besonders deutlich wird. Daher ist eine derartige Besetzung der Stellen sinnvoll, die gewährleistet, daß Untersuchungen je nach Forschungsgegenstand nur von Frauen, nur von Männern oder auch von beiden durchgeführt werden können.
Leider trägt die Sexualwissenschaft weltweit dieser Forderung wenig Rechnung. Es gibt zwar Sexualwissenschaftlerinnen, doch sind diese kaum in leitenden Positionen zu finden. Das spiegelt sich auch in dieser Denkschrift wieder, in der die Beiträge aus den etablierten Institutionen von fünf Männern und nur einer Frau verfaßt wurden. Das Fehlen von Sexualwissenschaftlerinnen im universitären Oberbau betrifft auch die Abteilungen für Sexualwissenschaft in Hamburg und Frankfurt.
In der Konsequenz wurde Forschung in diesem Bereich nicht nur jahrzehntelang von Männern dominiert, sondern sie hat sich auch an männlicher Sexualität bzw. Realität orientiert. Den Projekten der autonomen Frauenbewegung ist es zu verdanken, daß diese Einseitigkeit in unser Bewußtsein gerückt wurde. Sie haben in den verschiedensten Arbeitsbereichen und durch neue Zugänge bisher nicht beachtete Elemente weiblicher Sexualität bzw. Realität freigelegt. Diese langjährige Arbeit hat gesellschaftliche Veränderungen bewirkt; die Stellenbesetzung in den oberen Etagen der westdeutschen universitären Sexualwissenschaft war davon allerdings bisher nicht berührt. Aus diesem Grund geht unseres Erachtens die Forderung einiger Projekte, zukünftige Stellen geschlechterparitätisch zu besetzen, nicht weit genug; diese Stellen müssen überproportional mit Frauen besetzt werden.
Das scheint uns auch angesichts der extremen Unterrepräsentation von Wissenschaftlerinnen an der Freien Universität Berlin sinnvoll zu sein. Dort hat sich seit 1980 nicht viel geändert, obwohl der Akademische Senat damals in seiner 240. Sitzung folgendes beschloß: "Der Akademische Senat strebt eine gleichmäßige Repräsentanz beider Geschlechter unter allen Beschäftigungsgruppen des wissenschaftlichen Personals an der FUB an. Er setzt sich für dieses Ziel ein, weil die bisherige Dominanz von Männern in vielen Fächern Forschungsthemen und -methoden zu eng gehalten und sich einseitig auf den Lehrbetrieb ausgewirkt hat. Der Akademische Senat fordert die Fachbereiche/
Aufgabe der daraufhin gegründeten Zentraleinrichtung zur Förderung von Frauenstudien und Frauenforschung ist es unter anderem, sich um die Erhöhung des Frauenanteils am wissenschaftlichen Personal zu bemühen. Da diesem Bemühen nur sehr geringe Einflußmöglichkeiten zugeordnet sind, hat sich an der Situation bisher wenig geändert. 1986 waren noch immer nur 8% der Professoren, 17,5% der Hochschulassistenten und 28.5% der Wissenschaftlichen Mitarbeiter Frauen. [5] Hier ist das Berliner Hochschulgesetz, in dem es heißt, "Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die Beseitigung der für weibliche Hochschulmitglieder bestehenden Nachteile hin" [6], nicht konkret genug und für die beschriebene Situation wenig hilfreich. Eine deutliche Akzentsetzung scheint uns hier notwendig. Deshalb fordern wir, daß künftige Institut für Sexualwissenschaft überproportional mit Frauen zu besetzen, insbesondere in den leitenden Positionen.
Die sich aus dieser Forderung ergebenden Probleme werden in dem Beitrag des autonomen Lesbenreferats im AStA der FU Berlin treffend zusammengefaßt.
Zum einen stellt sich die Frage, ob es zum Zeitpunkt einer Institutsgründung genug qualifizierte Sexualwissenschaftlerinnen geben wird, um auch den Oberbau mindestens paritätisch mit Frauen besetzen zu können.
Zum anderen ist die Geschlechterquotierung nur eine Seite der Medaille. Sie sagt noch nichts über die Verteilung der Stellen auf Vertreter/innen verschiedener sexueller Orientierungen. Denn ebenso wie das Geschlecht wirkt sich auch die Abweichung oder Nichtabweichung des Forschers/der Forscherin von der geschlechtlichen 'Normalität' auf die wissenschaftliche Arbeit aus. So müßte konsequenterweise die Möglichkeit bestehen, bestimmte Untersuchungen jeweils von homosexuellen oder heterosexuellen Frauen oder Männern, Transsexuellen oder Fetischisten (um nur einige Beispiele zu nennen) durchführen zu lassen. Da aber der Vielfalt des geschlechtlichen Lebens eine nur geringe Anzahl von Institutsstellen gegenüberstehen wird und zudem Einstellungskriterien, die die sexuelle Orientierung berücksichtigen, eine unzumutbare Ausforschung der Bewerber/innen verlangen würden, ist eine Quotenregelung hier nicht angemessen. Es müssen also andere Formen gefunden werden - Formen institutionalisierter Zusammenarbeit, die die Beteiligungsmöglichkeiten sexueller Minderheiten an Forschung und Lehre gewährleisten.
[1] Vgl. Senatsvorlage Nr. 2269/84 vom 10.4.1984; Mitteilung an das Abgeordnetenhaus vom 18.4.84 - Ders. Nr. 9/1042; 9/1201 - Schlußbericht[2] Geleitwort des Senators für Wissenschaft und Forschung; in: Magnus Hirschfeld - Leben und Werk; Berlin: Verlag rosa Winkel 1985, S. 7f
[3] vgl. Gunter Schmidt, Das große Der Die Das, Herbstein: März 1986
[4] Beschlußprotokoll der 240. Sitzung des Akademischen Senats vom 2.7.1980. Beschluß Nr. 240/1447/I/80. Zitiert nach: Zentraleinrichtung zur Förderung von Frauenstudien und Frauenforschung an der Freien Universität Berlin (Hrsg.): 6 Jahre danach - Zur Dialektik eines Fortschritts; Berlin 1986, S. 7
[5] Prozentzahlen aus: Zentraleinrichtung zur Förderung von Frauenstudien und Frauenforschung an der Freien Universität Berlin (Hrsg.): 6 Jahre danach - Zur Dialektik eines Fortschritts; Berlin 1986, S. 23
[6] Berliner Hochschulgesetz 1986 § 4 Abs. 2
aus: Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft (Hrsg.): Für ein neues Berliner Institut für Sexualwissenschaft. Eine Denkschrift. Berlin: edition sigma 1987. ISBN 3-924859-66-3. vergriffen